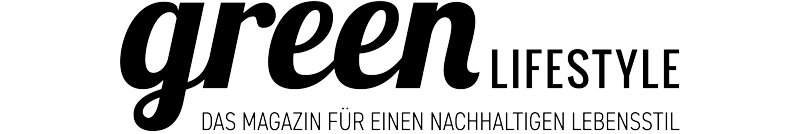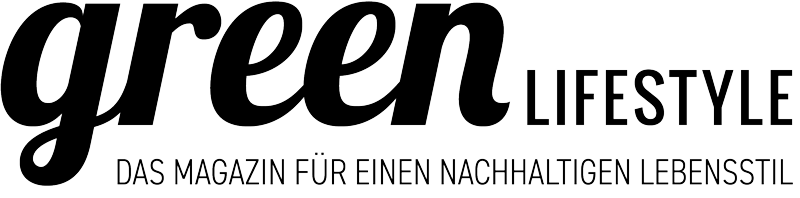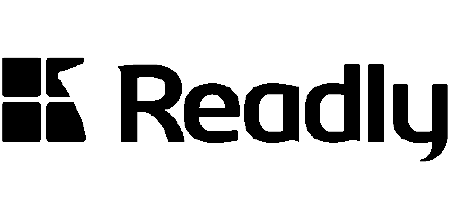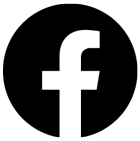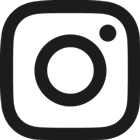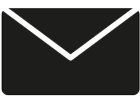Statistisch gesehen verbraucht jeder von uns jährlich mehr als 55 Liter Milch und fast 25 Kilogramm Käse. Aber nur ein kleiner Teil davon sind Bio-Produkte. Was ist eigentlich bei Bio-Milch anders? Ist sie auch gesünder? Und geht es Bio-Kühen wirklich besser?
Welche landwirtschaftlichen Erzeugnisse sich in Deutschland „bio“ nennen dürfen, ist in der EU-Ökoverordnung geregelt. Erzeugnisse, die diesen Kriterien entsprechen – also auch Bio-Milch – tragen das europäische Bio-Logo.

Ist Bio-Milch besser als herkömmliche Milch? Foto © StockMediaSeller via shutterstock.com
Inhaltsverzeichnis:
Vorschriften für Bio-Milch-Betriebe
Die verschiedenen Öko-Verbände wie Demeter oder Bioland haben teils noch strengere Vorschriften. Grundsätzlich gilt: Bio-Milch kommt von Kühen, die mehr Platz und Auslauf als konventionell gehaltene Milchkühe haben, und die Futter fressen, das nach den Kriterien der Öko-Verordnung produziert wurde.
Konkret bedeutet das Folgendes:
1. Ausreichend Platz für Kühe:
Ähnlich wie bei einer artgerechten Hühnerhaltung gibt es auch bei den Milchkühen Vorschriften. So müssen diese Milchkühe im Stall mindestens sechs Quadratmeter und auf Außenflächen mindestens 4,5 Quadratmeter Fläche zur Verfügung haben – für konventionell gehaltene Kühe gibt es keine Platzvorschriften. Zudem begrenzt die Öko-Verordnung auch die Zahl der Tiere pro Betrieb.
2. Kühe brauchen Auslauf:
Die Kühe müssen regelmäßigen Auslauf haben – möglichst auf einer Weide. Wenn die Umstände das nicht gestatten, muss es aber zumindest eine Auslauffläche geben, die die Tiere regelmäßig nutzen können.
3. Stallhaltung bei Bio-Kühen:
Die von Tierschützern verpönte Anbindehaltung, die die Bewegungsfreiheit der Tiere einschränkt, ist bei Bio-Milchkühen nur kleinen Betrieben erlaubt, die mindestens zweimal pro Woche Auslauf gewährleisten und die Tiere im Sommer auf einer Weide lassen. Alle anderen Ställe müssen ausreichend große Liegeflächen bieten, die zum Beispiel mit Stroh eingestreut werden. Sogenannte „Spaltenböden“, durch welche die Exkremente direkt abfließen, dürfen höchstens 50 Prozent der Stallfläche ausmachen.
4. Öko-Futter:
Das Futter der Kühe muss selbst aus ökologischem Anbau stammen – das bedeutet unter anderem Einschränkungen bei Dünger und Pflanzenschutzmitteln und den Verzicht auf Gentechnik. Das sogenannte „Raufutter“ – also etwa Gras oder Heu und haltbares Futter aus Silos – muss mindestens 60 Prozent der Nahrungszufuhr ausmachen. Ebenfalls mindestens 60 Prozent des Futters müssen entweder aus dem eigenen Betrieb oder der Region stammen.
5. Bessere Behandlung:
Auf die schmerzhafte Enthornung von Kälbern sollte verzichtet werden. Ausnahmen – etwa weil die Stallgröße nicht ausreicht und sonst Verletzungen drohen – müssen beantragt werden und unter Betäubung geschehen. Die Medikamentengabe durch Tierärzte ist bei Bio-Kühen strenger reglementiert, Hormone und Antibiotika zur Leistungssteigerung sind aber auch bei konventionellen Milchkühen verboten.
6. Verminderung der Zusatzstoffe und Verzicht auf Gentechnik:
Wie beim Futter dürfen auch bei der Weiterverarbeitung der Milch in Molkereien keine auf Gentechnik basierenden Produkte verwendet werden. Naturidentische oder synthetische Aromastoffe sowie die Zugabe synthetischer Vitamine sind ebenfalls tabu. Statt über 300 sind für Bio-Milch lediglich 47 Zusatzstoffe wie Pektin, Johannisbrotkernmehl oder Agar-Agar zugelassen. Bio-Milch gibt es daher nur von gesunden Kühen, und diese brauchen das entsprechende Futter dazu.
Zusammenfassung:
Bio-Milch kaufen: Aufs Siegel achten!
Produkte, die die Vorgaben der EU-Öko-Verordnungen erfüllen, dürfen sich „bio“ nennen und tragen das EU-Bio Logo. Darunter muss der Code für die zuständige Prüfstelle sowie die Herkunftsbezeichnung stehen – entweder „EU-Landwirtschaft“, „Nicht-EU-Landwirtschaft“ oder „EU- / Nicht-EU-Landwirtschaft“.
Bei vielen Produkten ist zusätzlich auch das sechseckige deutsche Biosiegel abgebildet, das aber nicht verpflichtend ist. Dazu kommen teilweise noch Logos der verschiedenen Bioverbände, deren Auflagen oft noch über die Biovorgaben der EU hinausgehen.
Das EU-Bio-Logo muss auf allen Bioprodukten abgebildet sein. Das deutsche Biosiegel ist häufig zusätzlich abgedruckt.
Wo kann man Bio-Milch kaufen?
Manche Bauernhöfe bieten völlig unbehandelte – lediglich gefilterte und gekühlte – Rohmilch direkt von der Kuh an. Als Vorzugsmilch bezeichnet man Rohmilch, die in Reformhäusern und Naturkostläden verkauft wird. Für Säuglinge, Kleinkinder, Schwangere, ältere und immungeschwächte Menschen sind Roh- und Vorzugsmilch jedoch nicht geeignet. Beide Milchsorten sind nicht hitzebehandelt und sollten vor dem Verzehr abgekocht werden. Bio-Milch gibt es beispielsweise in Supermärkten wie Rewe, Edeka und Tegut; Drogerien wie DM und Rossmann, aber auch in Naturmärkten wie Alnatura oder Denn’s Bio-Markt sowie bei Discountern wie Aldi und Lidl.
Welche Bio-Milcharten werden verkauft?
In den Kühlregalen der meisten Supermärkte findet sich Milch, die pasteurisiert, also für 15 bis 30 Sekunden auf 72 bis 75 Grad Celsius erhitzt wurde. Nach dieser Prozedur ist die traditionell hergestellte Frischmilch im Kühlschrank etwa sieben bis zehn Tage lang haltbar. Daneben gibt es noch sogenannte ESL-Milch (ESL steht für Extended Shelf Life), die kurz auf 85 bis 127 Grad Celsius erhitzt wurde und gekühlt bis zu drei Wochen lang haltbar ist.
Im Handel erkennt man die ESL-Milch an der Aufschrift „länger haltbar“. Wer Milch auf Vorrat kaufen möchte, sollte dagegen zur H-Milch greifen, die noch höher – auf mindestens 135 Grad Celsius – erhitzt wurde. Sie muss nicht gekühlt werden und hält sich ungeöffnet bis zu sechs Monate.
Allerdings schmeckt sie anders als Frischmilch und hat den sogenannten „Kochgeschmack“, den viele Milchtrinker als unangenehm empfinden. Und Vorsicht: Anders als Frisch- und ESL-Milch schmeckt verdorbene H-Milch nicht säuerlich.
Ist Bio-Milch gesünder?
In herkömmlicher Milch lassen sich weder mehr Rückstände oder Verunreinigungen nachweisen, noch beinhaltet sie weniger Vitamine oder Spurenelemente als biologische Milch. Aus diesem Grund besitzt die Bio-Milch gegenüber der konventionellen Milch gesundheitlich kaum Vorteile. Fakt ist: Wer zu einer biologischen Milch greift, fördert eine artgerechte Tierhaltung.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Kollateralschäden beim Konsum von Bio-Milch:
Bio-Milchkühe haben zwar mehr Platz und Auslauf und bekommen besseres Futter. Dennoch müssen auch sie, damit ihr Milchfluss nicht versiegt, regelmäßig kalben und werden von ihren Kälbern anschließend getrennt. Biokälber müssen zwar – im Gegensatz zu konventionellen – mit Milch gefüttert und in Gruppen gehalten werden.
Da sie keine Milch geben, werden die männlichen Kälber allerdings gemästet und geschlachtet. Auch wer Milch von Bio-Kühen trinkt und sonst kein Fleisch isst, kommt also nicht darum herum, Schlachtungen in Kauf zu nehmen.
Interessante Fakten zur deutschen Milchproduktion:
Weniger Kühe, mehr Milch.
2014 gab es in Deutschland 4,3 Millionen Milchkühe, die pro Jahr durchschnittlich 7400 Kilogramm Milch gaben. 1990 lag die Zahl der Milchkühe noch um zwei Millionen höher – sie produzierten allerdings im Durchschnitt nur 4700 Kilogramm Milch.
Fazit:
Biologische Milch bedeutet nicht, dass sie auch gesünder ist als normale Milch. Dennoch sollte diese immer bevorzugt werden, wenn man nicht gänzlich auf pflanzliche Alternativen umsteigen kann oder möchte. Der Kauf von Bio-Milch unterstützt eine artgerechte Haltung, durch die Tiere weniger Leid erfahren.
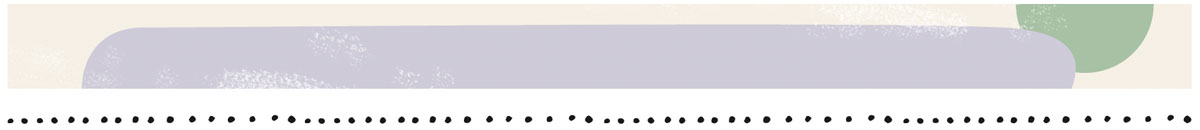
Noch mehr Inspiration für einen nachhaltigen Lebensstil
gibt‘s im green Lifestyle Magazin
im Abo, am Kiosk oder als eMag bei United Kiosk, iKiosk und Readly!
Außerdem immer informiert bleiben mit dem kostenlosen green Lifestyle Newsletter!
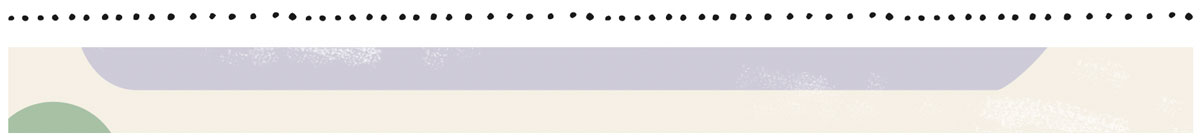

gibt‘s im green Lifestyle Magazin
im Abo, am Kiosk oder als eMag bei United Kiosk, iKiosk und Readly!
Außerdem immer informiert bleiben mit dem kostenlosen green Lifestyle Newsletter!